|
Dieser Text ist zuerst erschienen in: iz3w Nr. 275 (März 2004), Nicht vergeben, nicht vergessen - Deutscher Kolonialismus I, S. 30-33.
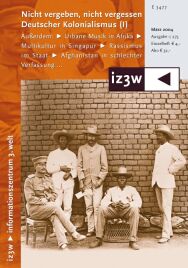
|
Unter Kolonialhistorikern wird darüber debattiert, ob die deutschen Kolonialverbrechen in Deutsch-Südwestafrika als direkter Vorläufer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gelten können. Doch obwohl der Massenmord an den Herero unter anderem in Konzentrationslagern statt fand, sprechen viele Argumente gegen solche Kontinuitätsthesen.
Für den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika,
dem ca. 65.000 Herero zum Opfer fielen,
hat Deutschland bis heute keinerlei Entschädigung
gezahlt. Die Herero People’s Reparation
Corporation hat daher 2003 vor US-Gerichten
die Bundesrepublik Deutschland sowie die
Deutsche Afrika Linien als Rechtsnachfolger
der Woermann-Linie und die Deutsche Bank
auf jeweils zwei Milliarden Dollar Entschädigung
verklagt. In der Anklageschrift heißt
es, diese Unternehmen hätten eine »brutale
Allianz mit dem kaiserlichen Deutschland«
geschlossen, die »schonungslos die
Versklavung und genozidale Zerstörung
des Herero-Stammes« verfolgt hätte.
Laut Kuaima Riruako, dem obersten Chief
der Hereros, ist diese Klage von den in
den USA erfolgreichen Prozessen ehemaliger
NS-Zwangsarbeiter gegen deutsche Firmen
inspiriert worden.
Die Weigerung der rotgrünen Bundesregierung, Entschädigungen an die Herero auch nur ins Auge zu fassen, verweist darauf, wie schwer sich die deutsche Gesellschaft mit der Erinnerung an die mit Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung verbundene Epoche des Kolonialismus tut. Warum nimmt sie einen so marginalen Platz im historischen Gedächtnis ein – gerade auch angesichts der zwar zunächst defizitären, mittlerweile aber intensiven Auseinandersetzung mit der Shoah? Geht dies auf die Befürchtung zurück, wer über die deutschen Verbrechen an Afrikanern und Asiaten spreche, müsse zwangsläufig den Holocaust relativieren? Oder schlägt uns hier die Sehnsucht nach dem Schlussstrich unter alle Vergangenheitsdebatten entgegen? Ist es überhaupt sinnvoll, den Genozid an den Herero immer unter dem argumentativen Fluchtpunkt »Auschwitz« zu diskutieren? Reduziert man auf diese Weise nicht die Kolonialgeschichte auf eine Vorläuferrolle für den Nationalsozialismus? Und in welchem historischen Verhältnis stehen überhaupt der Mord an den Herero und der an den europäischen Juden?
Kolonialismus als Geisteshaltung
Die Diskussion dieser Fragen hat gerade erst begonnen. Dass so große Erinnerungslücken in Bezug auf den Deutschen Kolonialismus herrschen, mag auch an dem geringen Stellenwert liegen, den die Kolonialismusforschung in der deutschen Wissenschaft bislang innehatte. Die deutsche Kolonialepoche wurde bislang vornehmlich unter dem Verdikt der »Marginalität« abgehandelt. Sie habe weder in den »Schutzgebieten« noch in der Metropole tiefergehende Spuren hinterlassen, lautete das Urteil.
Dieser mitunter im Ton der Erleichterung vorgebrachte Verweis auf einen randständigen Platz greift jedoch zu kurz. Er gilt weder für die ehemaligen Kolonien noch für das Deutsche Reich. Kolonialismus als mentale Struktur, als Geisteshaltung war auch in Deutschland nicht an die Periode formeller Kolonialherrschaft gebunden. Schon seit dem 16. Jahrhundert gab es Bemühungen, deutsche Kolonialgebiete in der »Neuen Welt« zu begründen. Vor allem im Verlauf des 19. Jahrhunderts flammte die Debatte um ein deutsches Ausgreifen in die Welt mit Vehemenz auf. Nach dem »Verlust« aller Kolonien gab es einen »kolonialen Phantomschmerz«; nach 1918 beeinflussten die Auswirkungen der kolonialen Erfahrung weiterhin Kultur und Gesellschaft Deutschlands. Und auch die Bundesrepublik bewegt sich bis heute in Gedanken und Strukturen, die in die Logik des europäischen kolonialen Projekts eingeschrieben sind.
Dass die Erinnerung an den Kolonialismus in der Regel keine Berücksichtigung fand und findet, hängt erstens mit dieser Einengung auf die Phase formeller Herrschaft über die außereuropäischen Gebiete zwischen 1884 und 1918 zusammen. Zweitens lebten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kaum Minderheiten aus ehemaligen »Schutzgebieten« in der Bundesrepublik, von denen Impulse zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ausgegangen wären – ganz im Gegensatz zu Frankreich oder Großbritannien. Und drittens stand die vergangenheitspolitische Beschäftigung mit dem deutschen Kolonialismus immer im Schatten des Zivilisationsbruches der Shoah, der historisch singulären Vernichtungspolitik im Nationalsozialismus.
In jüngster Zeit jedoch nimmt die Kritik an diesen blinden Flecken zu. Ursächlich hierfür sind nicht nur die internationalen, zumeist von den ehemaligen Kolonialländern sowie Dritte-Welt-Solidaritätsgruppen eingeforderten Debatten um koloniale Verbrechen, sondern auch drastische Veränderungen der Erinnerungspolitik in der Bundesrepublik. War die NS-Herrschaft in den fünfziger Jahren als eine nationale Katastrophe betrachtet worden, als deren erstes Opfer sich die Deutschen selbst sahen, gilt sie nun als singulärer Zivilisationsbruch. Die Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit gehört inzwischen zum Selbstverständnis der Republik, ja ist sogar zur »deutschen Staatsräson« (Die ZEIT) geworden.
In welcher Tradition aber Kolonialgenozid und Holocaust – oder genereller Kolonialismus und Nationalsozialismus – stehen und ob der Genozid an den Herero als »Vorgeschichte des Holocaust« (Jürgen Zimmerer) betrachtet werden kann, darüber streitet sich derweil die deutsche Historikerzunft. Im Hintergrund stehen dabei handfeste forschungspolitische Interessen und Überzeugungen. So sehen Kolonialhistoriographen nun die Möglichkeit, aus dem Schatten des »Dritten Reiches« herauszutreten.
In der gegenwärtigen Debatte scheinen manchmal die Kontinuitäten überstrapaziert oder diese gar in eine gerade Linie zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gegenüber den europäischen Juden gezwungen zu werden. Zwar mag es beide Male darum gegangen sein, die Intention, ein ganzes »Volk« auszurotten, zu realisieren. Die tendenzielle Gleichsetzung der kolonialen Praktiken mit der Vernichtungspolitik aber läuft Gefahr, beiden historischen Ereignissen nicht gerecht zu werden und Erkenntnismöglichkeiten zu vernebeln. Auch sollten im Elan der Forschung nicht nur die Plausibilitäten der eigenen These im Vordergrund stehen, sondern auch die Grenzen dieser konstatierten Traditionen zwischen kolonialer und nationalsozialistischer Vernichtungsgewalt in den Blick genommen werden.
Kühl kalkulierter Plan
Erster Schritt einer Untersuchung des möglichen Zusammenhanges zwischen dem Völkermord im ehemaligen Namibia und der Shoah sollte sein, die jeweiligen Genozide im systematischen Kontext ihrer jeweiligen Zeit zu analysieren. Zu klären wäre in Bezug auf den Völkermord an den Herero, ob er in der Tat singulär war, ob als einzige unter allen Kolonialmächten die Deutschen einen Kolonialgenozid verübten. Falls sich dies bestätigen sollte, müssten die Gründe hierfür eruiert werden. Was machte den Krieg in Deutsch-Südwestafrika so anders als die anderen Kolonialkriege, die sich doch sonst so ähnelten? Ein gemeinsames Kennzeichen der Kolonialkriege ist, dass sie angesichts der ungleichen militärischen Potentiale (Waffen, Know-how, Taktiken) stets höchst asymmetrisch geführt wurden. Überdies standen die »Eingeborenen« im Kriegsfall nicht unter dem Schutz der Haager Konventionen. Sie wurden von vornherein seitens der europäischen Mächte von allen Regeln ausgeschlossen, die für Kriege zwischen »zivilisierten Nationen« Gültigkeit haben sollten.
Eine Kernfrage sollte daher lauten: Wie wurde in der Wahrnehmung der deutschen Kolonialmacht nicht nur die Barriere zwischen Zivilist und Soldat aufgehoben, sondern wie kam es überhaupt zu dieser Entgrenzung von Gewalt? In dieser ging es darum, nicht mehr nur den Widerstand des Gegners zu brechen und die Kolonie zu befrieden, sondern den Gegner in toto auszulöschen. Offenbar kamen hier mehrere Momente zusammen, die in ihrer wechselseitigen Dynamik zu dieser Entgrenzung beitrugen. Wichtig, aber nicht unbedingt spezifisch deutsch war die Angst der Kolonialherren vor Prestigeverlust. Hinzu traten die aus dem Kriegsverlauf resultierende Enttäuschung und die Wut über die Unterschätzung eines Gegners, der sich als viel intelligenter als angenommen erwies. Warum aber nahm die »Schutztruppe« umgehend, aber irrigerweise an, dass die Hereros einen »Rassenkrieg« gegen alle Weißen intendierten? Woher rührte dieses Bedürfnis der deutschen Seite, sich zum unschuldigen Opfer eines Waffenganges zu stilisieren? Welche Rolle spielte die Dehumanisierung des Gegners, das vorgebliche »Aufräumen« mit den »Barbaren«?
All diese Momente kulminierten in der »Vernichtungsmentalität« des Befehlshabers General Lothar von Trotha, dessen Schießbefehl vom 2. Oktober 1904 die physische Auslöschung der Herero einleitete: »Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen.« Eine Biographie dieses Täters wäre von großem Nutzen. Schließlich sollte auch die Nachgeschichte berücksichtigt werden: Wie lässt sich die Rücknahme dieses Befehls durch Kaiser Wilhelm II. vom 8. Dezember 1904, die Ablösung von Trothas sowie die massive öffentliche Kritik auch innerhalb der Schutztruppe interpretieren? Als zu späte Einsicht, die aber dennoch für ein im Gegensatz zum Nationalsozialismus vorhandenes Unrechtsbewusstsein spricht? Oder lediglich als Lippenbekenntnis, das auf die Kontinuität genozidaler Mentalitäten in der deutschen Gesellschaft verweist?
Singulärer Antisemitismus
In einem zweiten Schritt muss sich jede Behauptung kolonialer Traditionen der Auseinandersetzung mit anderen Traditionen stellen. Zwar mag es sein, dass der Genozid an den Herero einen »wichtigen Ideengeber« für die nationalsozialistische Kriegführung in Osteuropa darstellte, wie der Kolonialhistoriker Jürgen Zimmerer postulierte. Er stünde, so Zimmerer, für den Bruch des letzten Tabus, nämlich die Vernichtung anderer Ethnien nicht nur zu denken, sondern auch in die Tat umzusetzen. Hitler selbst jedoch hatte offenbar andere historische Ereignisse vor Augen, als er am 22. August 1939 die militärischen Befehlshaber auf dem Obersalzberg über seine Vernichtungsabsichten im bevorstehenden Krieg unterrichtete und dabei an das kurze Gedächtnis der Weltöffentlichkeit anspielte: Schon »Dschingis Chan«, so der »Führer«, »hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt«, und »[w]er redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?«.
Wichtig wäre also, wenn denn »Rückgriffe« festgestellt würden, diese zu gewichten. Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen kolonialem Genozid und der Vernichtung der europäischen Juden. Der moderne, arbeitsteilige, bürokratisch geplante und staatlich verfasste Massenmord an den Juden orientierte sich vorwiegend an den Erfahrungen und »Lernprozessen« der Täter. In seiner Programmatik rekurrierte er dabei in erster Linie auf antisemitische Traditionsbestände. Erinnert sei an das Schlagwort »Lösung der Judenfrage«, das im öffentlichen Diskurs seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts präsent war und von den Nationalsozialisten mit dem Begriff der »Endlösung« aufgenommen wurde. Für die politische Praxis war der a priori erklärte Wille entscheidend, die jüdische Bevölkerung zunächst in Deutschland, später im gesamten besetzten Europa zu enteignen, zu entrechten und aus der Gesellschaft zu »entfernen«.
Wichtige Eskalationsstufen dieser »Entfernung« waren die Vertreibung der jüdischen Deutschen, die massierten Übergriffe auf deren physische Integrität während des Novemberpogroms 1938, der Überfall auf Polen im September 1939, der mit seinen Morden an der polnischen Intelligenz erste Formen einer Entgrenzung von Gewalt aufwies, und schließlich der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion seit Juni 1941. Weder führte also die Angst um einen eventuellen Prestigeverlust, wie im Falle der kolonialen Genozide, zu den Massentötungen in Osteuropa, noch ergaben sie sich aus den Kampfhandlungen, wie Wendy Lower vom Center for Advanced Holocaust Studies jüngst hervorhob.
In die Ukraine, so Lower, waren die Deutschen mit einem kühl kalkulierten Plan zum Völkermord einmarschiert. Panik, die Kriegsentwicklung oder der reale jüdische Widerstand hätten bei dieser Vernichtungsidee und -praxis keine Rolle gespielt. Ziel war, jeden Juden, dessen man habhaft werden konnte, in einer systematischen und flächendeckenden Aktion umzubringen. Zudem hätten sich die Formen der Lebensberaubung unterschieden: Hätten in der UdSSR vor allem Massenerschießungen und Exekutionen stattgefunden, so hätten die Deutschen 37 Jahre zuvor den Tod der Afrikaner in der Wüste an Hunger und Durst billigend in Kauf genommen. Die Thesen von Lower werfen somit noch einmal neu die Frage auf, ob der Begriff des Genozids jene Trennschärfe liefern kann, die sich die Genozidforschung von ihm erhofft. Historisch betrachtet waren Völkermorde ein offenbar höchst variables Ereignis, selbst wenn das Ergebnis immer entsetzlich war.
In einem dritten Schritt wäre zu fragen, ob kolonialer Rassismus und ein auf Vernichtung zielender Antisemitismus mit denselben Kategorien beschreibbar sind. Zwar kulminierten beide Denksysteme in einem ethnisch-völkischen Verständnis der Nation, in dessen Zentrum die Idee rassischer Homogenität stand. Doch dies war im Kaiserreich weder offizielle Staatsdoktrin noch politische Praxis, im Gegensatz zum Nationalsozialismus. Die Kombination eines Antisemitismus, dessen besonderes Kennzeichen der Glaube an die Allgegenwärtigkeit des jüdischen »Anderen« war (ob als »jüdisch-bolschewistische« oder »jüdisch-kapitalistische Weltverschwörung«), mit einem Kolonisationswahn, dessen Spezifik in der geglaubten Wieder-Aneignung »ehemals deutschen« Bodens in Osteuropa lag, ging in ihrem Destruktionspotential über die massenmörderische Dimension von Kolonialrassismus und -herrschaft hinaus. Diese Beobachtung ist nochmals ein Appell dafür, nicht vorschnell Genozide gleich zu setzen und den »Judaeozid« auch weiterhin als singuläres Verbrechen zu begreifen, dessen historische Verbindung zum kolonialen Völkermord sehr differenziert zu untersuchen ist.
Entschädigungsfragen
Wie schwierig die Analogisierungen von Kolonialgenozid und Holocaust sind, zeigt sich auch in der Frage einer adäquaten Politik gegenüber kolonialem Unrecht und vor allem dessen möglicher materieller Entschädigung. Die Forderungen der Hereros stehen im Kontext weltweit erhobener Forderungen nach Reparation und Restitution. Diese politischen Diskussionen um Folgeprobleme der Kriegs- und Zivilisationsverbrechen aller europäischen und nordamerikanischen Kolonialmächte sind Teil einer umfassenden Neuentwicklung im spannungsreichen Verhältnis von ehemaligen Kolonien und Kolonialmächten.
Neu ist, dass von der einen Seite Ansprüche auf materielle Entschädigung gestellt werden. Auf der dritten UN-Konferenz gegen Rassismus in Durban im Jahre 2001 forderten die afrikanischen Staaten Reparationen für 400 Jahre Versklavung und Kolonialismus sowie die Anerkennung des Sklavenhandels als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die andere Seite hingegen ist am ehesten zu symbolischen Schritten der Reue bereit. US-Präsident Bill Clinton entschuldigte sich für die Leiden, die durch den transatlantischen Sklavenhandel hervorgerufen wurden, nach 41 Jahren gestand 2001 Belgien seine Verantwortung für den Mord am kongolesischen Ministerpräsidenten Patrice Lumumba ein, und der Papst entschuldigte sich für die Inquisition. Diese Bitte um Vergebung der Sünden der eigenen Vorfahren mögen als oberflächliches »Bußritual« (Herrmann Lübbe) erscheinen. Als Mittel der internationalen Politik sind derartige selbstkritische Gesten aber von hohem symbolischem Wert. Sie sind Ausdruck dafür, dass der Norden seine Verantwortung für die Zivilisationsverbrechen des Kolonialismus und für die ihnen inhärenten kulturelle Demütigung der kolonisierten Gesellschaften anerkennt. Sie werden dementsprechend vom Süden als Genugtuung empfunden.
Insofern wäre es mehr als gerechtfertigt, wenn sich auch die Bundesrepublik als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches dazu durchringen könnte, die deutsche Schuld am Genozid an den Herero offiziell einzugestehen. Sicherlich kann angesichts der Dimension der Gräueltaten diese Form der »Wiedergutmachung« nur unzulänglich bleiben. Und natürlich sind solche geschichtspolitischen Bußrituale »ambivalente Übungen« (Clemens Knobloch), weil sie den einen medienwirksame Erleichterung bringt, die sich gerade in Deutschland zu einer Art »Sündenstolz« aufsummieren könnte, und den anderen eine Art Leidensnationalismus nahe legt und sie auf einen ewigen Opferstatus reduziert. Gleichzeitig jedoch ist die öffentliche Buße ein Indiz für die gestiegene Sensibilität gegenüber dem Unrecht der Vergangenheit. Sie beinhaltet stets auch die Selbstverpflichtung, dieses in Gegenwart und Zukunft zu unterlassen.
Die politisch strittige Frage ist, ob aus dieser Anerkennung von Verantwortung materielle Ansprüche abgeleitet werden können. Dass die Befürchtung vorherrscht, das Eingeständnis moralischer Schuld führe unweigerlich zu einer Legitimation der Kompensationsforderungen, zeigt das Beispiel von Außenminister Fischer. Er sagte bei seinem Besuch im Oktober 2003 in Windhoek, dass er keine Äußerung vornehmen könne, die »entschädigungsrelevant« wäre. Aber auch Frankreich will sich nicht bei der algerischen Bevölkerung für die Verbrechen während des Kolonialkrieges in Nordafrika entschuldigen.
Dass es schwierig ist, historische Schuld mit Geld zu begleichen, bedeutet aber nicht, dass man es nicht versuchen könnte. Jedoch bleibt die Frage, welche Kriterien für derartige Restitutionen im Kolonialkontext entwickelt werden können. Im Gegensatz zum NS geht es dabei weniger um tatsächlich zerstörte Reichtümer und juristische Ansprüche Einzelner, sondern um kollektive Entschädigungen an die Nachfahren der ehemals verfolgten Gruppe.
Verjährung ausgeschlossen
Der Politologe Rainer Tetzlaff nennt vier Aspekte, die bei derartigen finanziellen Kompensationen zu berücksichtigen sind: Kann es erstens für die in Frage stehenden Verbrechen Verjährungsfristen geben? Das dürfte im Fall von Völkermord eindeutig zu verneinen sein: Die Bundesrepublik trat 1968 der UN-Konvention über die Nichtanwendbarkeit der Verjährung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei und 1974 einer Europäischen Konvention, die Verjährung von Völkermord ausschließt. Zweitens: Inwiefern lassen sich andere Transferzahlungen gegenrechnen? Diese Position hat sich bislang die namibische Regierung zu Eigen gemacht. Sie unterstützt die Klage der Hereros nicht, sondern verweist auf die von der Bundesrepublik geleistete Entwicklungshilfe und die Unterstützung der DDR für die SWAPO, die nach der Unabhängigkeit Namibias 1990 die Macht übernommen hat. Man mag diese Position als »Pakt der Eliten« geißeln (Henning Melber). Fakt ist, dass sie die Entscheidung der souveränen Regierung Namibias ist.
Nach wie vor ungelöste politische Fragen sind jedoch drittens, an wen und wie lange die Entschädigungen gezahlt werden sollen? Und wie lässt sich viertens eine korrekte Übergabe der Mittel gewährleisten, die nicht dem häufigen Nepotismus selbsternannter Clanchefs Vorschub leistet, sondern tatsächlich den betroffenen Personen oder Erben oder der Gesellschaft als ganzes zu Gute kommt? Die ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen und verwandten Fragen auch über das Jahr 2004 hinaus wäre ein Anzeichen dafür, dass endlich auch in Deutschland ein selbstkritischer Erinnerungsdiskurs über die eigenen Kolonialverbrechen einsetzt.
*Birthe Kundrus ist Mitarbeiterin am Hamburger Institut für Sozialforschung und Herausgeberin des Sammelbandes »Phantasiereiche. Zur Kulturgeschichte des deutschen Kolonialismus« (Frankfurt 2003).
|